
WOHER KOMMT
EIGENTLICH DAS
WISSEN?





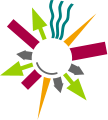
STADT-LAND-ERLEBEN
ALLGEMEIN
Die Bildungslandschaft im Überblick:
Formale Bildung:
Lernorte: Schule, Studium, berufliche Weiterbildung
Eigenschaften: strukturiert, starr, nach Lehrplan, leistungsorientiert, mit Abschlussprüfung /
Zertifikat
Non-formale Bildung:
Lernorte: Kurse, Workshops, Weiterbildungen
Eigenschaften: etwas flexibler, leistungsorientiert, mit Zertifikat
Informelles Lernen:
Lernorte: überall… Gespräche, Hobbys, soziale Medien, Bücher, Museen, Reisen
Eigenschaften: bewusst oder unbewusst, flexibel, selbstbestimmt, alltagsnah
Wir lernen ständig - in Gesprächen, aus Büchern, in sozialen Netzwerken, auf Reisen, im Beruf –
kurz: überall. Doch selten ist dieser Prozess bewusst. Wir wissen später nicht mehr, woher unser
Wissen genau stammt und wie sehr es unser Denken und Handeln beeinflusst. Häufig wird Wissen
mit Schule, Studium oder Beruf (Ausbildung / Weiterbildung) verbunden. Auch das „lebenslange
Lernen“ hat eher die berufliche Leistungsfähigkeit und Nutzbarkeit im Sinn. Allerdings beziehen
Menschen nur einen kleinen Teil aus dem Besuch dieser formalen Bildungseinrichtungen. Rund 70
bis 90 Prozent unseres Wissens eignen wir uns außerhalb ab - informell – ein Leben lang.
Zertifikate und Leistungsdruck
Formale Bildung ist klar geregelt: Schulen, Universitäten und berufliche Aus- und Weiterbildungen
folgen einem festgelegten Lehrplan. Sie vermitteln Wissen systematisch, strukturiert und oft
getrennt nach Fächern und Disziplinen. Es geht darum, verwertbare und vergleichbare
Kompetenzen zu vermitteln und dies mit einem Zertifikat zu belegen. Auf die Probleme dieses
Systems gehen wir an dieser Stelle nicht weiter ein.
Auch bei non-formalen Bildungsangeboten wie Workshops, Kurse und Weiterbildungen steht oft die
Verwertbarkeit des erworbenen Wissens im Vordergrund.
Überall und jederzeit
Deutlich vielfältiger und viel weniger greifbar ist das informelle Lernen. Es geschieht meist
kontinuierlich, unbewusst und ohne festgelegte Struktur: durch Ausprobieren, beim Austausch mit
Kollegen, durch Gespräche mit Freunden oder Nachbarn, in Sozialen Medien, beim Lesen, auf
Reisen, im Museum, im Internet oder in der Freizeit. Es ist nicht an einen bestimmten Ort
gebunden. Diese Art der Wissensaneignung ist eng mit unserem Alltag verwoben. So eng, dass wir
die Informationen oft auch gar nicht hinterfragen bzw. den Prozess reflektieren. Informelle
Angebote haben ein enormes Potential, aber in Anbetracht von FakeNews,
Desinformationskampagnen in sozialen Medien besteht hier eine große Gefahr.
Bildung spielt im öffentlichen Diskurs nur selten eine Rolle und wenn es doch einmal dazu kommt,
geht es um die schulische Bildung und um die letzten PISA-Ergebnisse. Eine Betrachtung der
gesamten Bildungslandschaft findet quasi nie statt. Es fehlt demnach auch an (politischer)
Anerkennung und finanzieller Unterstützung. Es entsteht darüber hinaus ein Spannungsfeld
zwischen offenen Lernkulturen und kommerziellen Angeboten, was zu ungleichen Teilhabechancen
führt. Ist der Zugang zu hochwertigen Angeboten begrenzt (z.B. aufgrund von Eintrittsgeldern,
Öffnungszeiten oder anderen Hürden), bleiben lediglich frei verfügbare Quellen. Diese sind nicht
immer schlecht, erfordern aber eine viel größere Kompetenz der Einordnung und Beurteilung
hinsichtlich des Wahrheitsgehaltes.
Unser Beitrag
Unsere Entdeckerpfade nutzen das Potential des öffentlichen Raumes als Lernort und bieten
jederzeit freien, flexiblen und selbstbestimmten Zugang zu Wissen und hochwertigen
Informationen - unabhängig von Alter, Herkunft oder sozialem Status.
Quellen / weiterführende Literatur
Wintersteiner, W.; Glettler, C.; Grobbauer, H.; Peterlini, H. K.; Rauch, F.; Steiner, R., 2023, Transformative
Bildung - ein Weg zur Nachhaltigkeit? IN: Magazin erwachsenenbildung.at. Das Fachmedium für Forschung,
Praxis und Diskurs. Ausgabe 49, 2023. Online: https://erwachsenenbildung.at/magazin/ausgabe-49
Opaschowski, H. W., 2014, Bildung zwischen Raum und Zeit - In: Schneider, M. (Hrsg.); Pries, M.
(Hrsg.): Bildungsräume in Bewegung. Perspektiven aus Wissenschaft, Wirtschaft und Praxis: Bielefeld,
Bertelsmann
Wischmann, A., 2014, Was haben kommunale Bildungslandschaften mit Bildung zu tun? - In: Pädagogische
Korrespondenz. Heft 49: Leverkusen, Budrich UniPress
Becker, G., 2020, Bildung für nachhaltige Entwicklung in urbanen Bildungslandschaften: Osnabrück,
NUSOVERLAG
Maurer, B.; Rieckmann, M.; Schluchter, J.-R. (Hrsg.), 2024, Medien - Bildung - Nachhaltige Entwicklung. Inter-
und transdisziplinäre Diskurse: Weinheim, Beltz Juventa
Kolleck, N.; Büdel, M.; Nolting, J. (Hrsg.), 2022, Forschung zu kultureller Bildung in ländlichen Räumen.
Methoden, Theorien und erste Befunde: Weinheim, Beltz Juventa
Hessischer Volkshochschulverband e. V. (Hrsg.), 2016, Lernräume IN: Hessische Blätter für Volksbildung – 66.
Jg. 2016 – Nr. 1: Bielefeld, W. Bertelsmann Verlag










STADT-LAND-ERLEBEN
ALLGEMEIN
Die Bildungslandschaft im Überblick:
Formale Bildung:
Lernorte: Schule, Studium, berufliche
Weiterbildung
Eigenschaften: strukturiert, starr, nach
Lehrplan, leistungsorientiert, mit
Abschlussprüfung / Zertifikat
Non-formale Bildung:
Lernorte: Kurse, Workshops,
Weiterbildungen
Eigenschaften: etwas flexibler,
leistungsorientiert, mit Zertifikat
Informelles Lernen:
Lernorte: überall… Gespräche, Hobbys,
soziale Medien, Bücher, Museen, Reisen
Eigenschaften: bewusst oder unbewusst,
flexibel, selbstbestimmt, alltagsnah
Wir lernen ständig - in Gesprächen, aus
Büchern, in sozialen Netzwerken, auf
Reisen, im Beruf – kurz: überall. Doch
selten ist dieser Prozess bewusst. Wir
wissen später nicht mehr, woher unser
Wissen genau stammt und wie sehr es
unser Denken und Handeln beeinflusst.
Häufig wird Wissen mit Schule, Studium
oder Beruf (Ausbildung / Weiterbildung)
verbunden. Auch das „lebenslange Lernen“
hat eher die berufliche Leistungsfähigkeit
und Nutzbarkeit im Sinn. Allerdings
beziehen Menschen nur einen kleinen Teil
aus dem Besuch dieser formalen
Bildungseinrichtungen. Rund 70 bis 90
Prozent unseres Wissens eignen wir uns
außerhalb ab - informell – ein Leben lang.
Zertifikate und Leistungsdruck
Formale Bildung ist klar geregelt: Schulen,
Universitäten und berufliche Aus- und
Weiterbildungen folgen einem festgelegten
Lehrplan. Sie vermitteln Wissen
systematisch, strukturiert und oft getrennt
nach Fächern und Disziplinen. Es geht
darum, verwertbare und vergleichbare
Kompetenzen zu vermitteln und dies mit
einem Zertifikat zu belegen. Auf die
Probleme dieses Systems gehen wir an
dieser Stelle nicht weiter ein.
Auch bei non-formalen Bildungsangeboten
wie Workshops, Kurse und Weiterbildungen
steht oft die Verwertbarkeit des erworbenen
Wissens im Vordergrund.
Überall und jederzeit
Deutlich vielfältiger und viel weniger
greifbar ist das informelle Lernen. Es
geschieht meist kontinuierlich, unbewusst
und ohne festgelegte Struktur: durch
Ausprobieren, beim Austausch mit Kollegen,
durch Gespräche mit Freunden oder
Nachbarn, in Sozialen Medien, beim Lesen,
auf Reisen, im Museum, im Internet oder in
der Freizeit. Es ist nicht an einen
bestimmten Ort gebunden. Diese Art der
Wissensaneignung ist eng mit unserem
Alltag verwoben. So eng, dass wir die
Informationen oft auch gar nicht
hinterfragen bzw. den Prozess reflektieren.
Informelle Angebote haben ein enormes
Potential, aber in Anbetracht von FakeNews,
Desinformationskampagnen in sozialen
Medien besteht hier eine große Gefahr.
Bildung spielt im öffentlichen Diskurs nur
selten eine Rolle und wenn es doch einmal
dazu kommt, geht es um die schulische
Bildung und um die letzten PISA-
Ergebnisse. Eine Betrachtung der gesamten
Bildungslandschaft findet quasi nie statt. Es
fehlt demnach auch an (politischer)
Anerkennung und finanzieller
Unterstützung. Es entsteht darüber hinaus
ein Spannungsfeld zwischen offenen
Lernkulturen und kommerziellen
Angeboten, was zu ungleichen
Teilhabechancen führt. Ist der Zugang zu
hochwertigen Angeboten begrenzt (z.B.
aufgrund von Eintrittsgeldern,
Öffnungszeiten oder anderen Hürden),
bleiben lediglich frei verfügbare Quellen.
Diese sind nicht immer schlecht, erfordern
aber eine viel größere Kompetenz der
Einordnung und Beurteilung hinsichtlich des
Wahrheitsgehaltes.
Unser Beitrag
Unsere Entdeckerpfade nutzen das Potential
des öffentlichen Raumes als Lernort und
bieten jederzeit freien, flexiblen und
selbstbestimmten Zugang zu Wissen und
hochwertigen Informationen - unabhängig
von Alter, Herkunft oder sozialem Status.
Quellen / weiterführende Literatur
Wintersteiner, W.; Glettler, C.; Grobbauer, H.; Peterlini, H. K.;
Rauch, F.; Steiner, R., 2023, Transformative Bildung - ein Weg zur
Nachhaltigkeit? IN: Magazin erwachsenenbildung.at. Das
Fachmedium für Forschung, Praxis und Diskurs. Ausgabe 49, 2023.
Online: https://erwachsenenbildung.at/magazin/ausgabe-49
Opaschowski, H. W., 2014, Bildung zwischen Raum und Zeit - In:
Schneider, M. (Hrsg.); Pries, M.
(Hrsg.): Bildungsräume in Bewegung. Perspektiven aus
Wissenschaft, Wirtschaft und Praxis: Bielefeld, Bertelsmann
Wischmann, A., 2014, Was haben kommunale Bildungslandschaften
mit Bildung zu tun? - In: Pädagogische Korrespondenz. Heft 49:
Leverkusen, Budrich UniPress
Becker, G., 2020, Bildung für nachhaltige Entwicklung in urbanen
Bildungslandschaften: Osnabrück, NUSOVERLAG
Maurer, B.; Rieckmann, M.; Schluchter, J.-R. (Hrsg.), 2024, Medien -
Bildung - Nachhaltige Entwicklung. Inter- und transdisziplinäre
Diskurse: Weinheim, Beltz Juventa
Kolleck, N.; Büdel, M.; Nolting, J. (Hrsg.), 2022, Forschung zu
kultureller Bildung in ländlichen Räumen. Methoden, Theorien und
erste Befunde: Weinheim, Beltz Juventa
Hessischer Volkshochschulverband e. V. (Hrsg.), 2016, Lernräume
IN: Hessische Blätter für Volksbildung – 66. Jg. 2016 – Nr. 1:
Bielefeld, W. Bertelsmann Verlag
WOHER KOMMT
EIGENTLICH DAS
WISSEN?




